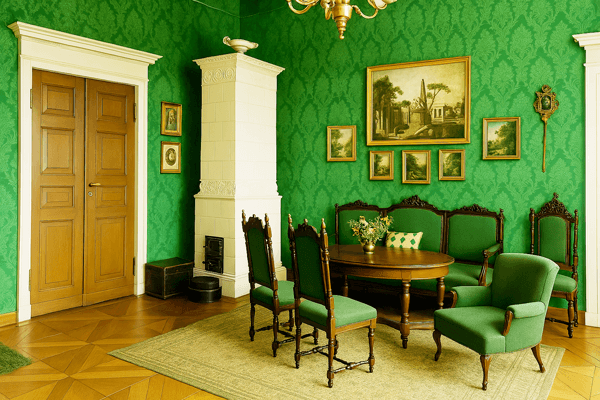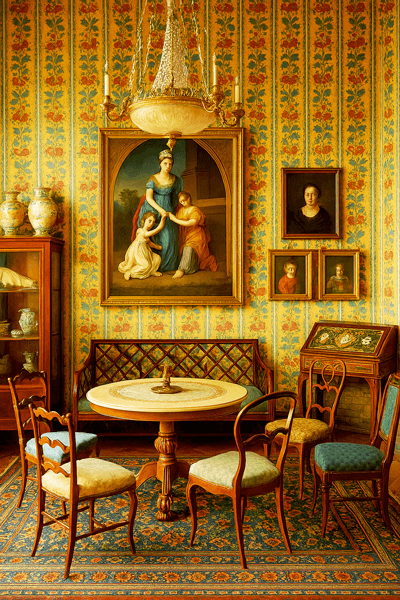Die Burg Angern befand sich in der nordöstlichen Altmark, etwa 5 Kilometer westlich der Elbe, in einer feuchten Niederungslandschaft, die durch zahlreiche Altarme, sumpfige Wiesen und temporäre Überflutungsflächen geprägt war. Die Wahl dieses Standorts war sowohl durch defensive als auch durch infrastrukturelle Überlegungen motiviert. Die Anlage nutzte die natürlichen Gegebenheiten der Landschaft, um durch Wassergräben, Inselbildung und kontrollierte Wegeführung ein hohes Maß an Wehrhaftigkeit zu erzielen. Zugleich ermöglichte die Lage zwischen Magdeburg, Tangermünde, Rogätz und Wolmirstedt die Einbindung in überregionale Verkehrs- und Kommunikationsnetze.
Die Gesamtanlage gliederte sich in drei Hauptzonen: die vollständig von einem Wassergraben umgebene Hauptinsel mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, eine kleinere südlich vorgelagerte Insel mit dem Bergfried sowie eine nordseitig angrenzende, nicht inselartige Vorburg auf festem Untergrund. Die Hauptinsel maß etwa 40 × 40 Meter (ca. 1.500 m²) und war über eine hölzerne Zugbrücke von Norden erreichbar. Diese Brücke mündete in ein Torhaus oder „Pforthäuschen“, das noch nach der Zerstörung 1631 als erhalten erwähnt wird (vgl. Dorfchronik Angern, Gutsarchiv, um 1650).
Der südlich vorgelagerte Wehrturm, der sogenannte Bergfried, stand auf einer eigenen Insel und war über eine separate, etwa 4 Meter lange Zubrücke mit der Hauptinsel verbunden. Mit einer Grundfläche von ca. 8 × 8 Metern und sieben Stockwerken diente der Turm nicht nur der Verteidigung, sondern auch der Machtdemonstration. Der Zugang erfolgte wahrscheinlich in das erste Obergeschoss. Eine erhaltene Schießscharte im Erdgeschoss sicherte den Bereich zur Grabenseite hin (vgl. Bauanalyse Milana, 2025).
Die Vorburg erstreckte sich nordwestlich der Hauptinsel, war nicht durch Wasser isoliert und beherbergte voraussichtlich Wirtschaftsgebäude wie Stallungen, Werkstätten und Speicherbauten. Auch das Brauhaus wird in der Zerstörungsbeschreibung von 1631 genannt, wenn auch nicht eindeutig lokalisiert. Diese Dreigliederung der Anlage – Hauptburg, Turminsel und festlandseitige Vorburg – entspricht einem für norddeutsche Niederungsburgen typischen Schema (vgl. Ziesemer 1994; Boockmann 2002).
Die Nähe zur Elbe verlieh der Burg zusätzliche strategische Bedeutung. Auch wenn sie nicht unmittelbar am Strom lag, befand sie sich im Einflussbereich eines der wichtigsten Wasserwege des Heiligen Römischen Reiches. Die Elbe war nicht nur für den Handel, sondern auch für militärische Truppenbewegungen von zentraler Bedeutung – ein Aspekt, der sich im Dreißigjährigen Krieg nachweislich konkret auswirkte.
Quellen:
- Dorfchronik Angern, Handschrift um 1650, Gutsarchiv Angern
- Gutsarchiv Angern, Rep. H Angern Nr. 412
- Ziesemer, Ernst: Die mittelalterlichen Burgen der Altmark. Magdeburg 1994
- Boockmann, Hartmut: Die Burgen im deutschen Sprachraum. München 2002