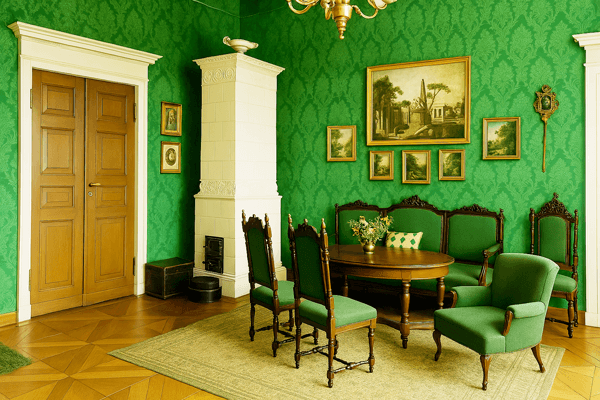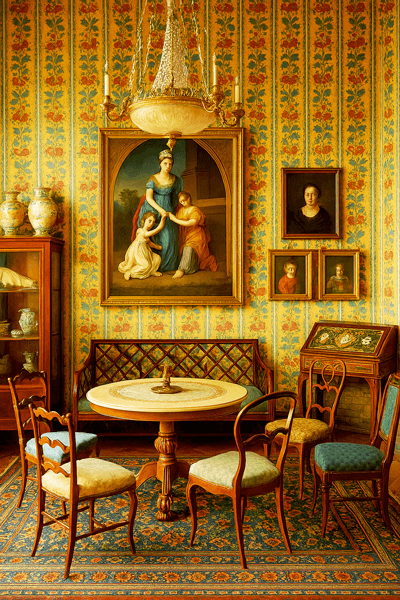Die Südseite der Hauptburg von Angern markiert in der spätmittelalterlichen Ausbaustufe einen der wehrtechnisch sensibelsten und zugleich baulich klar strukturierten Abschnitte der Anlage. Sie liegt der Turminsel zugewandt, von dieser durch einen etwa fünf Meter breiten Wassergraben getrennt. Diese klare Trennung diente der strategischen Aufteilung zwischen Verteidigung (Turm) und Verwaltung / Repräsentation (Hauptburg) und ermöglichte im Verteidigungsfall eine doppelte Kontrolle: Erst musste der Turm überwunden werden, dann die Brücke zur Hauptburg.
Topographie und Zugang
Der südliche Zugang zur Hauptburg erfolgte über eine schmale, erhöhte Holzbrücke, die vom erhöhten Eingang des Bergfrieds ausging und auf direktem Weg zur Türöffnung im ersten Obergeschoss der Südseite der Hauptburg führte. Diese Tür lag leicht zurückversetzt im Mauerwerk, vermutlich innerhalb eines kleinen Vorbaus oder Treppenturms. Der Zugang war dadurch nicht ebenerdig, sondern durch Höhenversatz zusätzlich gesichert.
Der Zugang im ersten Obergeschoss lässt erkennen, dass das Erdgeschoss der Südseite vollständig geschlossen oder nur durch Scharten durchbrochen war. Diese typische spätmittelalterliche Bauweise sollte das Eindringen erschweren und entsprach der Konzeption eines festungsartigen, nur kontrolliert betretbaren Baus.
Baustruktur und Nutzung
Die Südseite der Hauptburg war Teil eines viereckigen, fast quadratischen Burgkörpers, mit annähernd 40 × 40 Metern Grundfläche, vermutlich vollständig unterkellert. Die Südwand war massiv aus Bruchstein errichtet, wie die heute noch erhaltenen Sockel- und Gewölbereste nahelegen. Fensteröffnungen im Erdgeschoss fehlten größtenteils oder waren lediglich als Schlitzfenster (Licht- und Verteidigungsscharten) ausgeführt.
Das erste Obergeschoss der Südseite beherbergte vermutlich Nebenräume des Palas oder Wirtschafts- und Verwaltungsräume. Dort lagen vermutlich kleinere Kammern oder Räume, die über einen Flur mit dem östlichen Hauptflügel (Palas) verbunden waren. Aufgrund der Belichtungsarmut nach Süden – durch die direkte Nachbarschaft des Turms und die Enge des Grabens – waren hier nur kleinere, hochliegende Fensterachsen zu erwarten.
Militärisch-strategische Bedeutung
Die unmittelbare Nähe zur Turminsel verlieh der Südseite besondere strategische Relevanz:
Der Bergfried erhob sich nur fünf Meter entfernt, sodass ein Beschuss oder eine Beobachtung der Südwand unmittelbar möglich gewesen wäre. Diese Nähe wurde allerdings durch die Eigenständigkeit der Turminsel kompensiert – ein isolierter Vorposten, von dem aus Kommunikation mit der Hauptburg gezielt gesteuert werden konnte.
Die Südseite selbst war nicht repräsentativ gestaltet, sondern betont funktional und defensiv. Hinweise auf Zinnen, Wehrgänge oder Maschikulis auf der Südseite fehlen zwar in den erhaltenen Quellen, sind jedoch aufgrund der geringen Distanz zum Bergfried auch nicht notwendig gewesen: Der Schutz war durch die Staffelung von Graben, Turm und Brücke bereits gegeben.
Quellenbezug zur Zerstörung
Im Zuge der Kampfhandlungen von 1631 wurde auch die Südseite schwer beschädigt. Der umfassende Brand der Burganlage – nach dem Rückzug kaiserlicher Truppen – führte zur Aufgabe des alten Gebäudebestandes. In den späteren Quellen heißt es:
„Bei dem anschließenden Brand des Dorfes kommt auch die Burg zu Schaden. Einige Jahre hindurch befindet sich keine lebende Seele am Ort.“
(Publikation Angern 2022, S. 14–15)
In der Dorfchronik heißt es weiter:
„Ein größeres Wohnhaus scheint nicht vorhanden gewesen zu sein. Dafür werden aber die vier Keller und der alte Turm erwähnt.“
(Gutsarchiv, 1737/38)
Diese Aussagen legen nahe, dass auch die tragenden Mauern der Südseite nicht mehr vollständig erhalten waren. Spätere barocke Bauphasen verlegten den Herrschaftsmittelpunkt auf die südlich vorgelagerte Turminsel, womit die Südseite der mittelalterlichen Hauptburg endgültig ihre Funktion verlor.
Fazit
Die Südseite der Hauptburg von Angern war im Mittelalter eine klar funktionale Verteidigungs- und Zugangsseite, die durch ihre massive Bauweise und die topographische Verbindung zum Wehrturm strategisch stark positioniert war. Sie diente dem kontrollierten Eintritt in die Hauptburg, war jedoch architektonisch zurückhaltend gestaltet. Ihre bauliche Bedeutung endete mit der Zerstörung der Burg 1631, nach der sie nicht wiederhergestellt wurde.