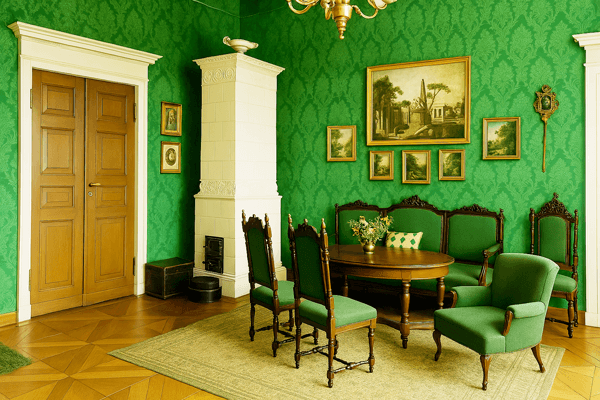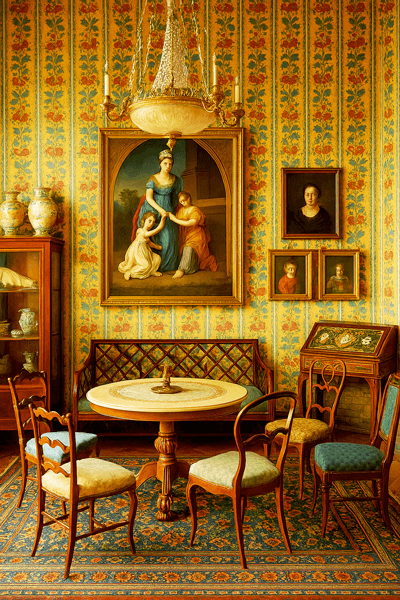Im Rahmen baubegleitender Untersuchungen im Herrenhaus Angern wurde in den Zwischendecken des barocken Baus ein bemerkenswerter Fund gemacht: Fragmente eines grün glasierten Kachelofens, gefertigt aus glasierter Ziegelkeramik mit dekorativen Reliefs. Besonders auffällig ist ein Herzmotiv, das in einer der erhaltenen Kachelbruchstücke erkennbar ist. Der Fund gibt nicht nur Hinweise auf die Nutzungsgeschichte des Gebäudes, sondern erlaubt auch Rückschlüsse auf die materielle und symbolische Kultur im Angern des 17. Jahrhunderts.
Materialität und Technik
Die Kachelfragmente bestehen aus Ziegelmasse mit bleihaltiger grüner Glasur, wie sie ab dem späten 15. Jahrhundert in Mittel- und Norddeutschland zur Anwendung kam. Es handelt sich nicht um industriell genormte Kacheln, sondern um handgeformte Stücke mit individuell eingeschnittenem oder aufgelegtem Dekor. Die Verwendung von Ziegel als Trägermaterial weist auf eine lokale oder regionale Herstellung hin – ein Befund, der in der Altmark vielfach belegt ist.
Die Glasur ist gleichmäßig, tiefgrün schimmernd und zeigt vereinzelte Blasenbildung – typisch für die damalige Brenntechnik. Die Tiefe des Reliefs deutet auf eine Einzelformtechnik hin; das Herzmotiv wurde vermutlich mit einem einfachen Stempel oder durch freihändiges Ausarbeiten gestaltet.
Symbolik des Herzmotivs
Die Darstellung eines Herzens auf einer Ofenkachel ist kein reines Ziermotiv, sondern trägt eine symbolische Bedeutung. In der volkstümlichen und höfischen Ikonographie der Frühen Neuzeit steht das Herz unter anderem für:
- Hausfrieden und familiären Zusammenhalt
- Treue und eheliche Verbindung – besonders, wenn es als alleinstehendes Motiv erscheint
- Frömmigkeit – in katholischer Tradition als „Herz Mariens“ oder „Herz Jesu“ mit Flammen, Strahlen oder Dornen
Die stilistische Schlichtheit des Musters lässt eine weltlich-symbolische Lesart wahrscheinlich erscheinen: Es handelt sich vermutlich um ein Zeichen von Zugehörigkeit, Geborgenheit oder Schutz im häuslichen Raum.
Kontext und Wiederverwendung
Die Kachelfragmente wurden in Zwischendecken des barocken Neubaus von 1735 gefunden. Ihre Verwendung dort zeigt eine typische Form des Wiedergebrauchs von Abbruchmaterial aus dem Vorgängerbau. Solche Bruchstücke dienten in Decken als:
- Füllmaterial zur Trittschalldämmung
- Feuchteregulierung
- Brandschutzlage zwischen Balken
Das spricht für einen wertschätzenden Umgang mit dem Material und möglicherweise auch für eine symbolische Weiterverwendung – die Übernahme des „Hausherzens“ in die neue Bauphase.
Denkmalpflegerische Bewertung
Der Fund ist aus denkmalpflegerischer Sicht von hohem Aussagewert, da er:
- die materielle Kontinuität zwischen Vorgängerbau und barocker Umgestaltung belegt,
- eine lokale Ofenkachelproduktion dokumentiert, die bisher kaum erforscht ist,
- und mit dem Herzmotiv einen Einblick in die symbolische Innenraumkultur des 17. Jahrhunderts bietet.
Für eine weiterführende Analyse wäre eine vergleichende Untersuchung regionaler Kachelöfen ebenso wünschenswert wie eine naturwissenschaftliche Glasur- und Tonanalyse.
Fazit
Das grün glasierte Kachelfragment mit Herzmotiv aus Angern ist nicht nur ein ästhetisches Zeugnis vergangener Wohnkultur, sondern auch ein Fragment kollektiver Erinnerung. In ihm überlagern sich Funktion, Symbolik und Geschichte auf materielle Weise – eingefügt zwischen den Etagen eines Hauses, das selbst zwischen den Epochen steht.