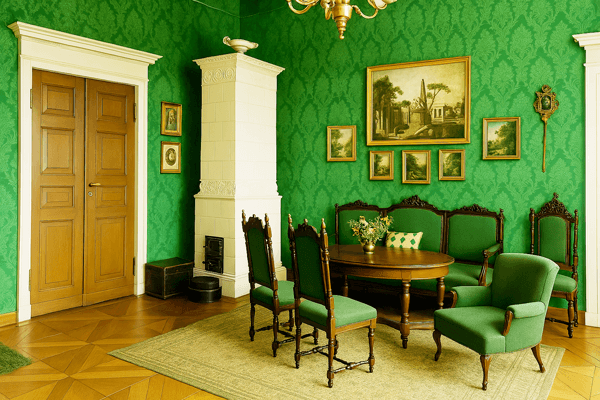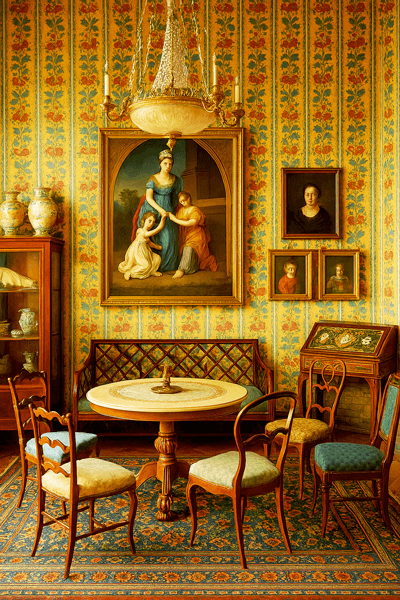Bezeichnung: Barocke Doppelflügeltür aus Eiche mit querliegenden Kassettenfeldern

Standort:
Innenbereich des Herrenhauses Angern heute im 1. Stock zwischen Flur und großem Saal (ursprünglich vermutlich Hauptzugang oder bedeutender Repräsentationsraum)
Datierung:
Hauptbestandteil vermutlich spätes 17. Jahrhundert (ca. 1670–1700). Verlängerung und Anpassung um 1738–1740 im Zuge des barocken Schlossneubaus durch General Christoph Daniel Freiherr von der Schulenburg
Material:
- Türblätter aus massivem Eichenholz, Kassetten aus dem vollen Holz geschnitzt
- Querliegende obere und untere Füllungen vermutlich spätere Ergänzungen aus gleichem oder ähnlichem Eichenholz
- Zarge und Beschläge nicht überliefert bzw. möglicherweise verändert
Konstruktion:
- Zweiflügelige Tür mit je drei Kassettenfeldern pro Flügel
- Mittelfelder hochrechteckig, obere und untere Felder querrechteckig, stilistisch dem Barock angepasst
- Kein klassisches Rahmen-Füllungssystem – Kassetten sind aus dem vollen Holz herausgearbeitet
Stilistische Einordnung:
- Verbindung von frühbarocken Handwerkstechniken mit späterer barocker Formensprache
- Geschweifte Profilierung (evtl. bei Querfeldern) deutet auf nachträgliche stilistische Angleichung
- Seltene Kombination von funktionaler Massivholzarbeit mit repräsentativem Anspruch
Bauhistorischer Befund:
- Die Tür ist das einzige erhaltene Eichenexemplar unter den ansonsten aus Kiefer gefertigten, barocken Innentüren
- Dies legt nahe, dass sie aus dem Vorgängerbau des Schlosses (vor 1735) stammt
- Im Zuge des Umbaus 1738 wurde sie mit hoher handwerklicher Sorgfalt verlängert und stilistisch integriert
Bedeutung:
- Zeugnis kontinuitätsbewusster Baukultur im Barock
- Seltenes erhaltenes Originalstück aus dem älteren Schloss Angern
- Beispiel für bewusste Wiederverwendung hochwertiger Bausubstanz
- Denkmalpflegerisch und kulturhistorisch von hohem Wert
Denkmalpflegerischer Steckbrief – Historische Tür Schloss Angern
Objekt:
Zweiflügelige Kassettentür, Eichenholz, profilierte Rahmenbauweise
Lage:
-
Obergeschoss, Verbindung Flur – Oberer Saal
Datierung:
Ursprünglich ca. 1650–1730, mit Anpassungen um 1735/40 (barocker Umbau unter Christoph Daniel von der Schulenburg)
Material:
Massives Eichenholz, handwerklich gearbeitet, teils nachträglich ergänzt
Maße:
(Bitte eintragen, falls verfügbar – z. B. Höhe x Breite)
Beschreibung und Bestand:
-
Türblätter: Zweiflügelig, symmetrisch gegliedert, je Flügel sechs Kassetten: drei hochrechteckige und zwei querrechteckige (oben und unten), profilierte Füllungen mit geschweiften Rahmungen
-
Rahmen: Ursprünglicher Türrahmen mit barocker Kehle und profiliertem Sturz (Verdachung angedeutet)
-
Beschläge: Ursprüngliche oder historisierende Eisenbeschläge verloren; Schlüsselloch vorhanden, vermutlich Kastenschloss 18. Jh.
-
Oberfläche: Freigelegte Eiche, wohl ehemals farblich gefasst oder geölt; heute sichtbar: stark gealterte Patina, einzelne Ausbesserungen
Baugeschichtliche Einordnung:
-
Türblätter stammen sehr wahrscheinlich aus dem Vorgängerbau des Schlosses, der auf den erhaltenen Kellern der mittelalterlichen Vorburg nach dem Dreißigjährigen Krieg um 1650–1735 errichtet wurde.
-
Die querliegenden Kassetten deuten mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine spätere Verlängerung hin, vermutlich im Zuge des barocken Schlossumbaus 1735–1740, um die Tür an das neue Raummaß anzupassen.
-
Die Tür ist ein seltenes Beispiel für wiederverwendete Innenarchitekturteile aus einem zerstörten Vorläuferbau – sie verkörpert damit die Kontinuität vom feudalen Gutshaus zur barocken Schlossarchitektur.
Bedeutung aus denkmalpflegerischer Sicht:
-
Historisch bedeutend als bauliches Zeugnis der Wiederaufbauzeit nach dem Dreißigjährigen Krieg und der barocken Repräsentationsarchitektur unter Christoph Daniel von der Schulenburg
-
Materialhistorisch bedeutsam durch die Verwendung massiver Eiche mit handwerklicher Ausführung
-
Stilkritisch interessant durch die Kombination älterer Türblattgestaltung mit barocker Raumfassung
-
Konservatorisches Ziel: Erhalt der Tür in ihrer aktuellen Substanz, denkmalgerechte Restaurierung unter Berücksichtigung von Holzschutz, ggf. Ergänzung stilgerechter Beschläge