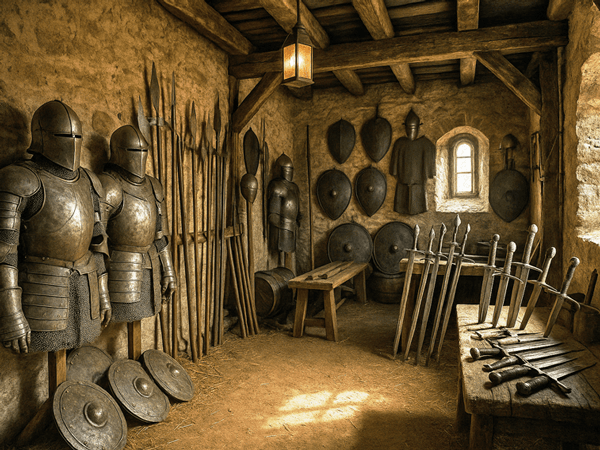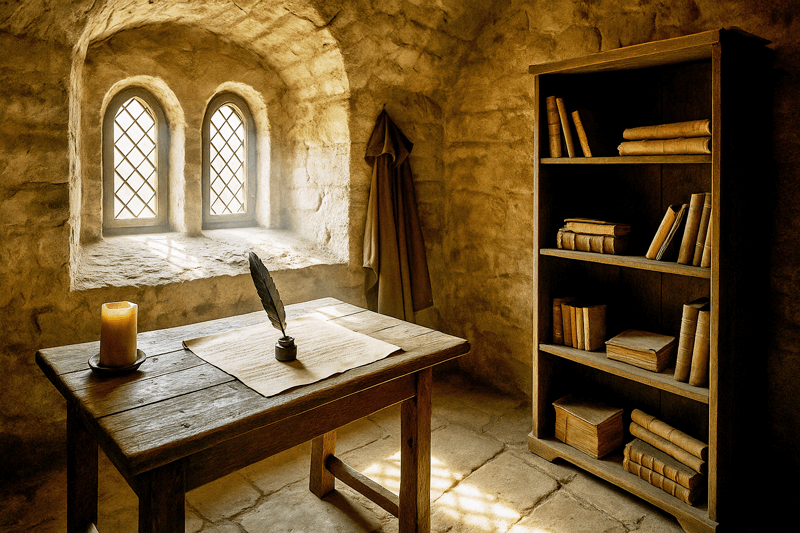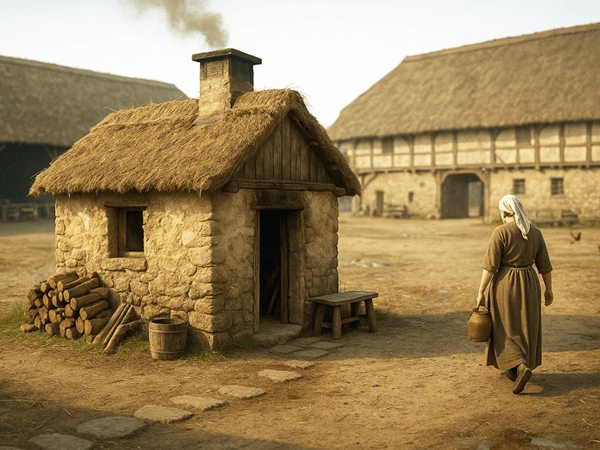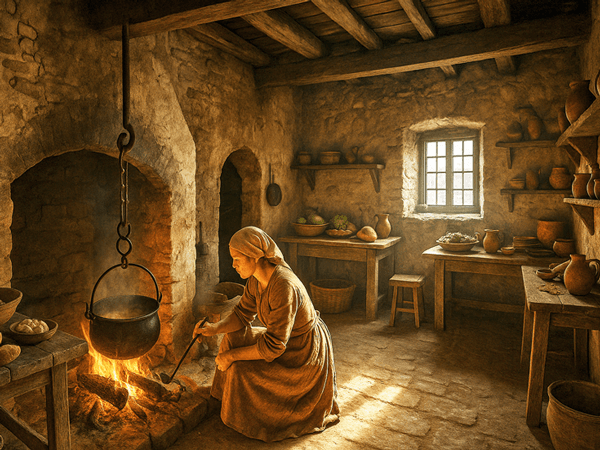Die Südinsel der Burg Angern bildet einen eigenständigen, verteidigungsorientierten Baubereich innerhalb der mittelalterlichen Wasserburganlage. Zentraler Bestandteil ist das vollständig erhaltene Erdgeschoss des Wehrturms (Bergfried) mit zugehörigen Wirtschafts- und Lagerräumen in Form zweier Tonnengewölbe sowie einem separaten Brunnen. Die erhaltenen Befunde zeigen, dass die Südinsel im Hochmittelalter nicht lediglich einen Einzelbau trug, sondern als autarke Verteidigungs- und Versorgungseinheit konzipiert war.
Zusätzlich deuten weitere Beobachtungen auf zusätzliche, bislang nicht vollständig erfasste mittelalterliche Baustrukturen auf der Südinsel hin: Im Keller des heutigen Hauptgebäudes des Wasserschlosses Angern, das um 1745 auf älteren Fundamenten errichtet wurde bzw. einen Vorgängerbau aus dem 17. Jahrhundert umformt hat, ist m Keller Bruchsteinmauerwerk sichtbar. Dieses Bruchsteinmauerwerk unterscheidet sich klar von den barocken und klassizistischen Aufmauerungen und könnte zu weiteren mittelalterlichen Wirtschafts- oder Verteidigungsbauten gehört haben.
Zugang zum Wehrturm (Bergfried)
Ein möglicher Zugang zum Wehrturm vom Palas aus erfolgte nicht ebenerdig: Auf der Nordseite des Bergfrieds befindet sich im Erdgeschoss lediglich eine Schießscharte, jedoch keine Tür. Möglicherweise bestand eine hochgelegene Brücke, die aus dem ersten Obergeschoss des Palas zur Südinsel führte, auch wenn dafür keine baulichen Reste erhalten sind. Dies könnte möglicherweise durch eine Untersuchung der noch verschütteten Gewölbe des südlichen Palas geklärt werden.
Zusätzlich erfolgte die Erschließung des Bergfrieds über das angrenzende Tonnengewölbe, von dem aus ein Zugang zum Turminneren bestand. Diese doppelte Erschließung sicherte sowohl die Verteidigungsfähigkeit als auch die interne Beweglichkeit der Besatzung.
Die doppelte Erschließung des Wehrturms von der Südinsel aus – über das Tonnengewölbe und möglicherweise über eine hochgelegene Brücke – sicherte die vollständige Autarkie der Südinsel im Verteidigungsfall. Dies deutet klar auf eine weitergehende Bebauung hin, die über Bergfried und Wirtschaftsgewölbe hinausging und eine eigenständige, dauerhaft verteidigungsfähige Besatzung ermöglichte.
Eine archäologische und bauhistorische Untersuchung der unteren Mauerschichten könnte wertvolle Aufschlüsse über die ursprüngliche Bebauung und die vollständige Funktionsgliederung der Südinsel liefern. Die erhaltene Substanz – Bergfried, Tonnengewölbe, Brunnen sowie mögliche weitere Baureste – macht die Südinsel der Burg Angern zu einem herausragenden und ungewöhnlich gut erhaltenen Beispiel strategischer Wasserburgenarchitektur im norddeutschen Raum.
Brückenverbindung zwischen Palas und Bergfried (hypothetische Ableitung)
Lage und Kontext: Zwischen dem Bergfried auf der Nordostecke der Südinsel und dem ca. 5 Meter entfernten Palas auf der Nordinsel, über den Wassergraben hinweg.
Bauweise und Rekonstruktion: Bauliche Reste einer Brücke oder Brückenanbindung sind nicht erhalten. Die Annahme einer erhöhten Verbindung basiert ausschließlich auf folgender Befundlage:
- Im Erdgeschoss des Bergfrieds auf der Palasseite befindet sich nur eine Schießscharte, keine Tür.
- Der Zugang zwischen Palas und Bergfried muss daher im ersten Obergeschoss gelegen haben.
- Typologisch sind solche hochgelegenen Verbindungen bei vergleichbaren Wasserburgen üblich (vgl. Ziesar, Lenzen).
Funktion (rekonstruiert): Eine Brücke hätte eine gesicherte Verbindung zwischen dem Palas (Wohn- und Repräsentationsbereich) und dem Wehrturm ermöglicht, ohne eine direkte Bodenverbindung zu schaffen. Im Verteidigungsfall hätte die Brücke schnell entfernt oder zerstört werden können.
Bedeutung: Auch wenn die Brücke selbst hypothetisch bleibt, ergänzt die angenommene Struktur sinnvoll das Verteidigungskonzept der Gesamtanlage und belegt die hochmittelalterliche Planung einer mehrstufigen Sicherung und könnte anhand der erhaltenen Gewölbestruktur des südlichen Palas näher untersucht werden.
Gesamtbedeutung
Die Südinsel der Burg Angern bewahrt mit dem erhaltenen Bergfried, den vollständig intakten Tonnengewölben und der funktional logisch rekonstruierten Verbindung zur Hauptburg ein äußerst seltenes vollständiges Verteidigungs- und Versorgungssystem einer hochmittelalterlichen Wasserburg. Der Bauzustand erlaubt wertvolle Erkenntnisse zur Organisation und Verteidigung mittelalterlicher Burganlagen im norddeutschen Raum.
Lesen Sie hier die Beschreibung der Burginsel um 1350
Quellen
- Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Brandenburg, München 2000.
- Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Sachsen-Anhalt I, München 1996.
- Lütkens, Udo: Burgen und Herrensitze in der Prignitz, Berlin 2011.
- Bergner, Heinrich: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Wolmirstedt, Magdeburg 1911.