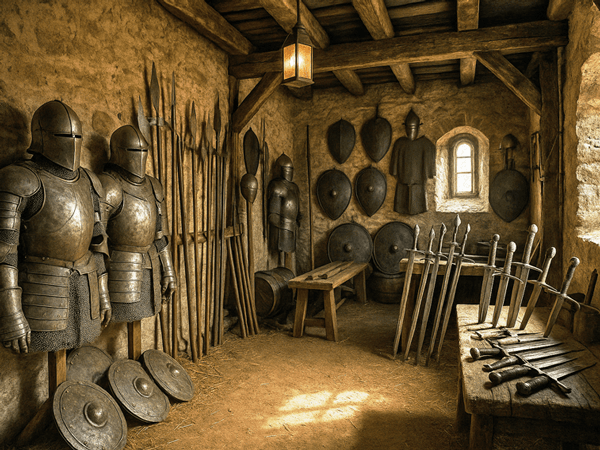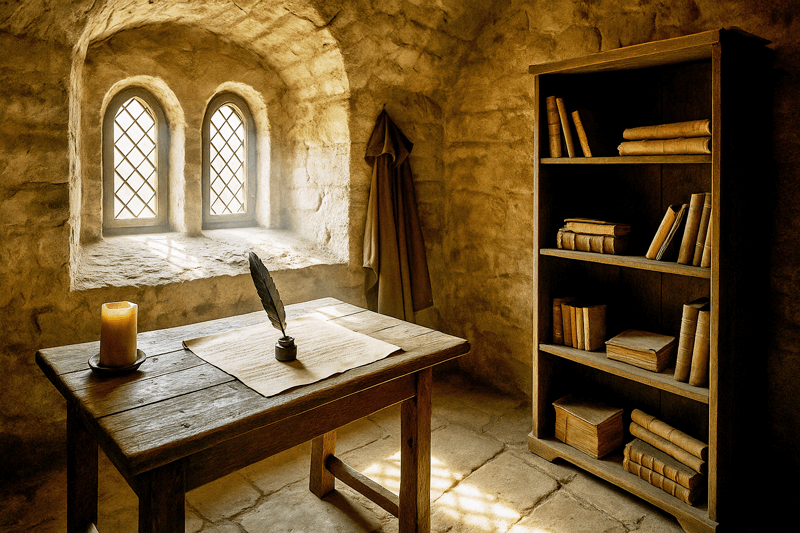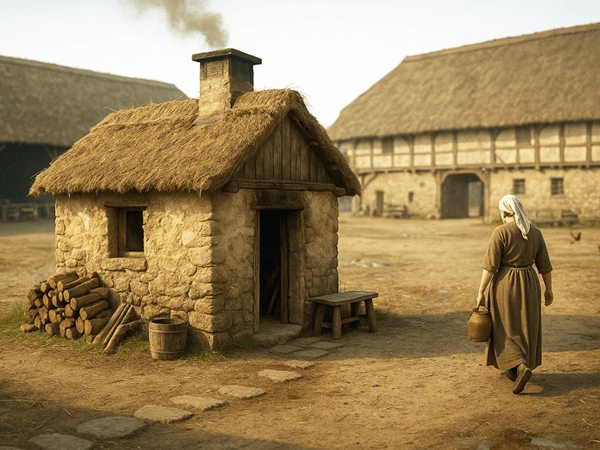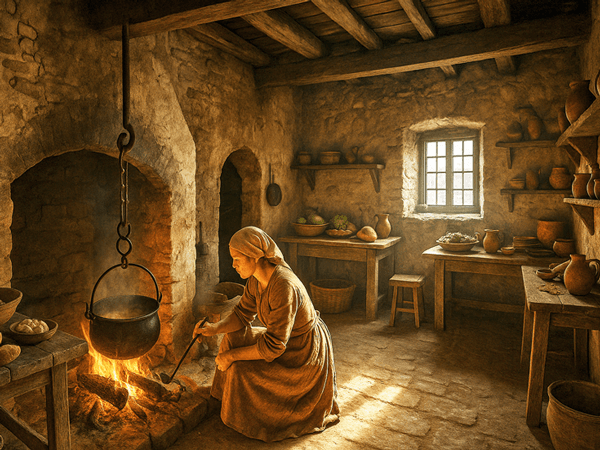Der im Erdgeschoss des Palas der Burg Angern erhaltene Umkehrgang stellt ein bau- und funktionsgeschichtlich bedeutendes Element hochmittelalterlicher Binnenarchitektur dar. Seine charakteristische 180°-Kehre, die vollständige Einwölbung und die Verbindung zweier paralleler Kellerzonen deuten auf eine durchdachte Erschließungsstruktur hin, die wirtschaftlichen und klimatischen Anforderungen entsprach. Der Befund ermöglicht Rückschlüsse auf die Organisation der Hauptinsel um 1340 und ergänzt die Analyse der erhaltenen Gewölbeanlage.
Befund A7: Umkehrgang im Erdgeschoss des Palas der Burg Angern
Lage und Bauform: Der abgewinkelte, tonnengewölbte Verbindungsgang liegt im Erdgeschoss des Palas und verbindet zwei auf gleichem Niveau liegende Gewölberäume. Der Zugang erfolgt über eine schmale Passage mit sofortiger Richtungsänderung, die visuelle Einsicht verhindert – ein typisches Merkmal sogenannter „Umkehrgänge“, wie sie im 13. und 14. Jahrhundert vereinzelt in Kloster- und Wehrarchitektur belegt sind. Die lichte Breite beträgt etwa 1,50 m und erlaubt eine Nutzung auch mit kleinen Transportmitteln.
Bauliche Einbindung: Der Gang ist teilweise in die westliche Außenwand integriert, verläuft jedoch überwiegend im Innenraum. Die Westwand – im Bereich des Gangs vermutlich 1,30 bis 1,50 m stark – sichert die Statik. Der ursprüngliche ebenerdige Zugang vom Hof ist heute durch eine Ziegelmauer verdeckt.
Materialität: Die Wandflächen bestehen aus unregelmäßigem Bruchsteinmauerwerk, das Tonnengewölbe aus kleinformatigen Ziegeln. Die homogene Ausführung legt eine einheitliche Bauphase um 1340 nahe. Der zweischichtige Aufbau mit Bruchsteinwänden und Ziegelgewölbe entspricht einem in der Altmark verbreiteten Bautypus.
Licht und Funktion: Die seitlich versetzte Fensterstellung – in Flucht mit Ein- und Ausgang des Umkehrgangs – erlaubte indirekte Belichtung der Gangzonen. Obwohl der Gang selbst fensterlos ist, fiel durch diese Anordnung Tageslicht in die Eingangsbereiche. Ein Wandpodest an der Südwand des nördlichen Raums unterstützt die Annahme funktionaler Differenzierung im Lagerbereich.
Raumbezug: Der Gang verbindet den südlichen Hauptraum mit einem nördlich gelegenen Gewölberaum. Die 180°-Kehre leitet vom westlichen Zugang zurück nach Osten. Die Außenwand misst an der engsten Stelle vermutlich nur 70–80 cm.
Funktionale Bewertung: Der Gang war Teil einer internen Erschließung ohne Öffnung zum Innenhof. Er diente der kontrollierten Bewegung von Personen und Gütern zwischen den Räumen und verhinderte direkte Sichtachsen. Seine großzügige Breite und geschützte Lage sprechen für eine Nutzung im Bereich der Vorratswirtschaft.
Bauhistorische Bedeutung: Der Umkehrgang ist ein selten dokumentiertes Beispiel hochmittelalterlicher Raumorganisation in norddeutschen Burganlagen. Seine vollständige Erhaltung, die originalen Materialien und die Integration in die Kernstruktur machen ihn zu einem Schlüsselbefund der Burg Angern.
Erhaltungszustand: Die originale Struktur ist vollständig erhalten. Die teilweise Auffüllung des Innenhofs im 18. Jahrhundert berücksichtigte den Bestand der Gewölbe – wie eine Quelle von 1737 (Rep. H Angern Nr. 412, Nr. 4) bestätigt.

Erhaltene mittelalterliche massive Bruchsteinwand mit Eingang zum abgewinkelten Verbindungsgang (links)

Umkehrgang Eingang in nördliches Gewölbe
Quellen
- Dorfchronik Angern, 1650 (Erwähnung der vier Keller)
- Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 412, Nr. 4 (18.11.1737)